Gerhard Richter und das Prinzip der Unschärfe in der Beratung
6. August 2013 von denkmodell
Besonders in der Fach- und Expertenberatung sind genaue Problemanalysen, exakte Zustandsdiagnosen und präzise Lösungsvorschläge angesagt. Wer sich hingegen in eine Ausstellung des zeitgenössischen Malers Gerhard Richter begibt, der findet möglicherweise gute Gründe, warum gerade das Unscharfe, Ungefähre und Grobgerasterte in vielen Beratungssituationen das Mittel der Wahl ist.
Zwei Zitate sollen hierfür herangezogen werden. Gerhard Richter schreibt in seinen Notizen von 1964–1965: „Ich verwische, damit alle Teile etwas ineinanderrücken. Ich wische vielleicht auch das Zuviel an unwichtiger Informationen aus.“ Ludwig Wittgenstein formuliert in Philosophische Untersuchungen § 71: „Ist das unscharfe Bild nicht oft gerade das, was wir brauchen?“
Der böse Blick der Beratenden?
Seit dem Aufkommen des naturwissenschaftlichen Denkens besteht der Wunsch nach genauestmöglicher Wahrnehmung der Welt.1 Lupen, Brillen, Mikroskope und Teleskope sollen die natürliche Sehkraft verstärken und eine glasklare Sicht auf die Dinge ermöglichen. Damit verbunden ist der Wunsch, die sichtbare Welt besser kontrollieren zu können. Der „scharfe Blick“ ist in fast jeder Kultur ein Synonym für Beherrschung und Kontrolle, das „scharfe Mustern“ einer Person ist eine Herrschaftsgeste und eine Aggression, wie sie zum Beispiel Polizisten im Verhör vorbehalten ist. Das „Fixieren“ war bis ins 19. Jahrhundert hinein vielfacher Auslöser für Duelle und die unselige Tradition des „bösen Blicks“ war der Grund für zahlreiche menschliche Tragödien.2
In der Beziehung zwischen Beratenden und Klient*innen ist dieser „scharfe“ Blick besonders dann gefürchtet, wenn er sich auf die Klient*innen selbst und seinen eigenen Anteil an einer problematischen Situation richtet. Fast unausweichlich mobilisiert das Klient*innensystem die Widerstands- und Selbstschutzmechanismen bis hin zur Ablehnung der Beratenden. Aber es gibt Möglichkeiten, eine solche Blockadesituation zu verhindern. Zum Beispiel versuchen die im systemischen Beratungsansatz verwendeten Fragetechniken, genau diesen „bösen“ fixierenden Blick zu vermeiden und stattdessen den Klient*innen dabei zu helfen, in einen Spiegel zu schauen, in dem er nur sich selbst sehen kann – und nicht den Blick der Beratenden. Dieser Grundgedanke der so genannten „systemischen Fragen“ lässt sich gut an den beiden Figuren Sherlock Holmes und Colombo3 illustrieren.
Während ersterer den Verdächtigen mit einem Hagel von direkten „scharfen“ Fragen in die Enge treibt („Wo waren Sie gestern zwischen acht Uhr und acht Uhr dreißig?“), fragt Inspektor Colombo so lange freundlich, „naiv“ und indirekt, bis der*die Mörder*in von alleine zu dem Schluss kommt, dass er sich besser der Polizei stellen sollte. Systemische Fragen nehmen die Klient*innen geistig an der Hand und laden zu einem Spaziergang im System ein. Ein Beispiel dafür sind so genannte „zirkuläre Fragen“, die den Klient*innen zu einem Perspektivwechsel einladen, zum Beispiel „Wenn ich Ihre Mitarbeiter*innen fragen würde, wie sie die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Vorgesetzten wahrnehmen, was würden sie vermutlich antworten?“ Am Rande noch eine makabre Pointe des Lebens: der Darsteller von Inspektor Colombo, Peter Falk, hatte tatsächlich ein Glasauge, wodurch ihm das „Fixieren“ seiner Gegenüber ohnehin nur schwer möglich gewesen wäre…
Unschärfe als Schutz
Das nachstehende Bild von Gerhard Richter basiert auf einem Foto von Leni Riefenstahl und zeigt ein Begräbnisritual der Nuba im Sudan. Bemerkenswert ist dabei unter anderem, dass Richter die Bildmitte besonders unscharf gezeichnet hat. Er begründete diese Entscheidung damit, dass er die Intimsphäre der Gezeichneten, ihre Trauer, ihre Emotion und ihre Verletzlichkeit vor dem Auge der Betrachtenden schützen wollte.

Auch Berater*innen müssen ihre Klient*innen schützen. Sie müssen nicht alles aussprechen, was sie wahrnehmen, nicht alles beschreiben, was geschieht, nicht jede Schwäche ihres Klient*innensystems benennen. Berater*innen, die zum Beispiel eine Organisationsdiagnose durchführen, stoßen immer auf Themen und Zusammenhänge, die jenseits der unsichtbaren Schamgrenze der Organisation liegen, die an berechtigte Tabus rühren und Menschen bloßstellen können. Die professionelle Herausforderung besteht darin, diese Informationen in einer Form an die Organisation zurückzuspiegeln, bei der die Beteiligten in diesen Spiegel hineinschauen mögen, ohne verletzt zu werden und deshalb offen bleiben für notwendige Veränderungsimpulse. Dies gelingt durch die richtige Mischung von genauer Beschreibung und gezielter „Unschärfe“ im Feedback der Beratenden.
Ein Beispiel aus unserer Praxis. Unser Auftrag lautete ursprünglich, ein Fortbildungsprogramm zu evaluieren. Hierzu führten wir zahlreiche Gespräche mit den zuständigen Mitarbeiter*innen der durchführenden Institution. Zu unserer Überraschung begannen die meisten Gespräche mit dem Satz „Bitte schließen Sie erst einmal die Tür. Ich erzähle Ihnen jetzt nämlich etwas…“. Ungewollt wurden wir zur „systemischen Müllabfuhr“ und zu Hoffnungsträgern der Mitarbeiter*innen, die sich dringend eine Veränderung in ihrer Führungskultur wünschten. Die Frustration konzentrierte sich auf die Person der Geschäftsführung, der*die uns als cholerische, überforderte und beratungsresistente Persönlichkeit geschildert wurde.
Symptomatisch: Das Anbrüllen von Mitarbeiter*innenn im Leitungsbüro hatte zu Beschwerden des Betriebsrats geführt, woraufhin die Führungskraft den Einbau einer Doppeltür veranlasst hatte…
Als Beratende in dieser Situation öffentlich den Finger auf die Wunde zu legen, die Führungskraft bloßzustellen oder gar zum „Problem“ zu deklarieren, hätte jegliche Chance auf Veränderung verspielt. In einer solchen Konstellation hilft der alte systemische Leitsatz „Don’t blame the person, blame the system!“. In der Tat war das Verhalten der kritisierten Führungskraft nur möglich, weil es im System keine korrigierenden Mechanismen gab. Die nachgelagerte Abteilungsleitungsebene hatte sich in der Resignation bequem eingerichtet, die nächst höhere Ebene war um Konfliktvermeidung bemüht und die Führungskraft selbst fühlte sich unverstanden, überlastet und allein gelassen. Unsere offizielle Diagnose spiegelte also ein weiches, unscharfes Bild der Organisation wider, das zwar die Dramatik der Situation erfasste, zugleich aber den Beteiligten genügend Schutz vor Gesichtsverlust und Schuldzuweisung gewährte. Nur so blieb der Weg offen für erste vorsichtige Veränderungsschritte.
Systemische Ignoranz – Erkenntnis durch Vergröberung
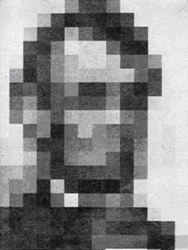
Der Begriff der systemischen Ignoranz ist in Google nicht zu finden und wird dennoch seit Jahren in der Beratung und im Management – zum Teil mit ironischem Unterton – verwendet. Gemeint ist damit die Fähigkeit, unwesentliche Details auszublenden und durch intuitives oder bewusstes Vergröbern das Wesentliche im Blick zu behalten. Zur Illustration dieser Eigenschaft ist das nachfolgende Rasterbild hilfreich.
Wer versucht, die Bedeutung dieses Bildes durch Auszählung der kleinen grauen Quadrate zu erfassen und dabei vielleicht noch eine wissenschaftliche Klassifizierung der unterschiedlichen Grautöne vornimmt, kommt nie zum Ziel. Um zu erkennen, wen das Rasterbild darstellt, muss man die Augen so eng zusammenkneifen, dass die Quadrate verschwimmen und ineinander fließen. Dann erst erkennt man das Bild eines früheren US-amerikanischen Präsidenten. Beratende benötigen diesen „unscharfen“ Blick, um das Wesen einer Organisation erkennen zu können – jenseits von Umsatzzahlen, Organigrammen oder Bilanzen.
Besonders in der Auseinandersetzung mit komplexen Organisationssystemen gehört das intuitive Bauchgefühl eines*einer Beraters*in zu den wichtigsten Instrumenten, um urteils- und entscheidungsfähig zu bleiben. Der Leitsatz „Besser ungefähr richtig als genau falsch“ gilt in hohem Maße auch für Manager*innen in Führungspositionen, denen im täglichen Strom von kleinteiligen Sachinformationen droht, den Blick auf das Wesentliche zu verlieren. Diese Kunst des professionellen Ignorierens hat unter dem Schlagwort „intuitives Management“ Einzug in die Fachliteratur gehalten. Darunter versteht man gemeinhin einen „Managementstil, der Entscheidungen aus dem Bauch heraus trifft und sich mehr auf den sechsten Sinn als auf die analytische, objektive Vernunft verlässt.“ (onpulson Wirtschaftslexikon).
Fuzzy logic und soft control
Das 1994 erschienene Buch „Fuzzy Thinking“ 4 von Bart Kosko kommt zunächst daher wie das Werk eines kalifornischen Späthippies: Ying-Yang Zeichen auf dem Umschlag und viele Zitaten von buddhistischen und griechischen Philosophen. Gleichwohl löste es einen Innovationsschub aus, der schon in den ersten Jahren nach seiner Veröffentlichung zu zehntausenden neuer technischer Patente führte. Worum geht es? Der wesentliche Ansatzpunkt des Buches und der daraus entwickelten „fuzzy technology“ beruht auf der Alltagserkenntnis, dass die theoretisch-mathematische Welt zwar zwischen richtig und falsch, schwarz und weiß unterscheiden kann, sich die komplexen Systeme der reale Welt aber eher entlang einer Skala unterschiedlicher Grautöne verhalten, oft gespickt mit Widersprüchen, Ungewissheiten und Informationslücken.
Eine technische Herausforderung besteht daher darin, Computern die Kunst des ungefähr Richtigen beizubringen, wenn sie etwa U‑Bahn Systeme steuern sollen, Thermostate von Kühlschränken oder die Elektronik von Fahrzeugen. Auch im Management komplexer Prozesse und Systeme zeigt sich die Herausforderung des „ungefähr Richtigen“: Wie können wir steuern und entscheiden, ohne alle Fakten zu kennen oder in einer Flut von Daten zu ertrinken? Wie kann eine wirksame Kontrolle von Abläufen erfolgen, ohne die Organisation durch ständige Eingriffe zu paralysieren oder ihr die notwendige Flexibilität zu rauben, um sich auf unerwartete Situationen einzustellen? Eine der möglichen Antworten hierauf wird mit dem Begriff „soft control“ umschrieben und ist für Management und Organisationsberatung gleichermaßen interessant. Ein zentraler Gedanke ist dabei die Steuerung durch „Prinzipien“ statt durch „Regeln“.
Wer versucht, ein Unternehmen durch ein komplexes Regelwerk zu steuern, das die Farbe der Arbeitskleidung, den Zeilenabstand in Geschäftsbriefen und die Formulargröße bei Bestellungen festlegt, muss scheitern. Prinzipien hingegen schaffen eine Basis für gemeinschaftlich abgestimmtes Handeln in der Organisation, zum Beispiel „Qualität geht vor Geschwindigkeit“, „Der*die Kund*in hat immer recht“, „Führung heißt Vorbild sein“, etc.. Prinzipien basieren auf gemeinsamen Werten. Sie stiften Identität in der Organisation und geben zugleich dem*der Einzelnen die notwendigen Freiheitsgrade zu vernünftigen, situativ angemessenen Entscheidungen. Kurz gesagt: Regeln sind zu befolgen, Prinzipien hingegen müssen interpretiert werden – das genau ist der Geist von „fuzzy thinking“!
Kernprägnant oder randscharf?
Diese Unterscheidung zwischen „kernprägnant“ und „randscharf“ traf ursprünglich der Linguist Georg Steiner in einem völlig anderen Zusammenhang, doch beschreibt sie trefflich das Dilemma moderner Organisationen bei dem Versuch, ihre innere und äußere Identität zu bestimmen. Genügt eine „randscharfe“ Grenze, die durch Verträge, Rechtsformen, Betriebsuniformen, Logos, Flaggen und Briefpapier markiert ist? Oder geht es vielmehr um den Kern des inneren Selbst einer Organisation?
Das klingt esoterisch, ist aber sehr konkret: Welches sind die Werte, der „Spirit“, der Stil und die Weltanschauung, die unverwechselbar in allen Produkten, Dienstleistungen, Verhaltensweisen und Vorgängen erkennbar sind, egal wer der Ausführende ist und wie die Sache konkret aussieht? Kernprägnante Organisationen brauchen wenig Regeln, aber klare Prinzipien – hier schließt sich der Kreis zum oben beschriebenen „fuzzy thinking“. Ist die Piratenpartei eine eher kernprägnante oder eher randscharfe Organisation? Und woran erkennt man ein Apple Produkt? Organisationen, die sich ausschließlich durch Randschärfe definieren, ähneln einer tauben Nuss:
Alle Energie geht in die Aufrechterhaltung der Schale, während der innere Kern verdorrt. Demhingegen haben kernprägnante Organisationen die irritierende Eigenschaft, sich in Netzwerke, Fördergemeinschaften, Cluster oder Facebook-Initiativen aufzufasern, die keine klare Grenze kennen und dies auch nicht anstreben. Viele neuere gesellschaftliche Bewegungen definieren sich zunächst durch einen „unsichtbaren“ Kern von Glaubenssätzen und Prinzipien (wie die Occupy-Bewegung). Die Frage „Bist Du Mitglied oder nicht?“ ist nicht beantwortbar, die richtige Frage lautet hier: „Wie nah oder fern stehst Du zum Kern?“ Nicht selten besteht der Kern auch aus einem gemeinsamen Projekt oder Produkt, zu dem die Beteiligten in unterschiedlicher Form und Intensität beitragen.
Dieser Typ der „unscharfen“ Organisation stellt Manager*innen und Organisationsberater*innen vor völlig andere Herausforderungen als eine Organisation mit genau definierten Außengrenzen. Kernprägnante Organisationen haben besondere Lebenszyklen, andere Wachstumsgesetze und müssen spezifische Bedrohungen bewältigen. Sie repräsentieren den Organisationstyp des 21. Jahrhunderts, beflügelt durch virtuelle soziale Netzwerke und temporäre, flexible Formen der Zusammenarbeit.
Der Blick in die Weite

Als Caspar David Friedrich das hier abgebildete Gemälde „Mönch am Meer“ schuf, verweigerte er dem*der Betrachter*in – bis auf die Kontur der Düne – jegliche Konkretheit. Zwei Schiffe, die ursprünglich auf dem Meer zu sehen waren, wurden wieder übermalt, der Übergang zwischen Himmel und Meer ist fließend. Nichts soll den Blick des Betrachters in die Weite, in das Ungefähre und Mögliche behindern. Organisationsberater erstellen solche Gemälde häufig zusammen mit dem Klienten. Damit ist nicht unbedingt das physische Malen mit Pinsel und Farbe gemeint (auch dies kann hilfreich sein), sondern die geistige Befreiung vom Diktat des Faktischen, von Prognosen, Marktstudien und Trendanalysen. Dabei müssen die Klient*innen nicht selten (metaphorisch gesprochen) aus ihren Büros herausgezerrt und einsam auf die Düne gestellt werden, damit sie wieder in die Ferne schauen können.
Vor allem operativ hochbegabte Manager*innen tun sich schwer damit, die angenehme Konkretheit des Tagesgeschäfts hinter sich zu lassen und den Blick in die Weite zu richten, wo vieles möglich, aber nichts sicher ist. Dabei helfen oft klassische Instrumente der Beratung wie die Visionsklausur, die Zukunftswerkstatt oder eine angeleitete Reise ins eigene Selbst.5 Nicht selten sind drastische Mittel notwendig, damit die „Macher*innen“ ihre Rüstung abstreifen und sich ungeschützt der Zukunft stellen. Dazu begab sich einer unserer Kund*innen aus der Automobilbranche mit Führungskreis zunächst in eine Altkleiderkammer des Roten Kreuzes, wo sich alle Teilnehmenden „neu“ einkleiden mussten, um danach zusammen das Wochenende in einem Kloster zu verbringen…
Fazit: Worauf es beim „unscharfen“ Beraten ankommt
Wir haben nun einige Situationen kennengelernt, in denen sich Beratende und/oder ihre Klient*innensysteme aus guten Gründen dem Anspruch entziehen, genau und präzise zu sein. Unsere Beispiele bezogen sich auf so unterschiedliche Themen wie Problemdiagnosen und Feedback, Organisationsgrenzen, Steuerungs- und Kontrollmechanismen, Zukunftsbilder oder Informationsverarbeitung. Was aber ist das diesen Beispielen zu Grunde liegende Prinzip? Kurz gesagt, es geht immer um den Schutz des Möglichen vor dem Faktischen, um das Spannungsfeld von machbar und denkbar. Nur so haben Entwicklung und Veränderung auf individueller und organisatorischer Ebene eine Chance. Bei der Beratung und Begleitung von Veränderungsprozessen ist es genau diese Spannung, aus denen Neues entsteht und Altes in Würde verabschiedet werden kann.
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir durchgängig das so genannte grammatikalische Geschlecht – es schließt Männer und Frauen gleichermaßen ein
2 Vgl.: Ullrich, W.: Die Geschichte der Unschärfe, Berlin 2002
3 Beliebte Fernsehserie der 70–80er Jahre mit Peter Falk in der Hauptrolle
4 Fuzzy, engl, bedeutet: verschwommen, unscharf, flockig
5 Zum Beispiel die z.Zt. en vogue befindliche „Theorie U“ nach Otto Scharmer, vgl. www.presencing.com

