Was tun Unternehmen, um innovativer zu werden?
28. April 2016 von Anna Schulte
Im letzten Beitrag zu Innovation haben wir uns gefragt: Was macht Organisationen innovativ? Heute schauen wir auf die Frage: Welche Hebel nutzen Organisationen und Unternehmen, um (noch) innovativer zu werden? Darauf gibt es sicher viele Antworten – eine Antwort, die wir in unserem (Kund*innen)Umfeld immer häufiger hören lautet: Wir suchen nach „innovativen Formen der Zusammenarbeit“. Dazu zählt mittlerweile fast selbstverständlich die zunehmende Ermöglichung virtueller Teamarbeit und andere praktische Fragen von Zusammenarbeit. Doch was, wenn das nicht „reicht“?

Der Berliner Anwalt für Gesellschaftsrecht Konrad Bechler betreut viele Unternehmen mit flachen Hierarchien: Neugründungen mit hohen Ambitionen nach Arbeit auf Augenhöhe oder GmbHs mit dem Wunsch nach Veränderung ihrer (Macht)Strukturen. Menschen, die auf der Suche sind nach mehr Beteiligung, weniger Top-Down, mehr Miteinander – Firmen auf der Suche nach der passenden Rechts- und Organisationsform.
Konrad Bechler weiß, dass es auf Vieles juristische Antworten gibt, es aber immer auch um andere Herausforderungen geht: Wie entscheiden wir? Wer entscheidet was? Wie kommunizieren wir? Wieviel Machtkonzentration darf und muss es geben? Fragen, denen auch wir im Beratungsalltag bei denkmodell begegnen. Was treibt Menschen an, innovative Modelle der Zusammenarbeit zu erproben? Warum ist das überhaupt reizvoll? Und wie innovativ sind diese Unternehmen wirklich?
Anna Schulte und Marcus Quinlivan haben sich mit Konrad Bechler zu einem Gespräch getroffen – die Fragen haben sie sich dabei quasi gegenseitig gestellt…
Konrad, du berätst viele Unternehmen mit flachen Hierarchien. Wie sieht dein eigenes Arbeitsumfeld aus?
Konrad Bechler: Flache Hierarchien unter Anwälten ist etwas ganz normales. Anwälte lassen sich schwer einordnen in ein Hierarchiemodell. Wir sind eine Partnerschaft und arbeiten ganz selbstverständlich in einer Kultur der flachen Hierarchie.
Marcus Quinlivan: Das kennen wir auch von unseren Kunden: je einfacher es ist, dass Mitarbeitende bzw. Partner oder Gesellschafter einer Organisation auch außerhalb der Organisation selbstständig arbeiten und erfolgreich sein können, umso wichtiger ist eine „kuschelige Kultur“ innerhalb der Organisation. Es braucht ja etwas, für das es sich zu bleiben lohnt. Ich entscheide mich quasi immer wieder neu für mein Unternehmen.
Heißt das, dass Arbeit zum Familienersatz wird?
KB: Ja, ein Stück weit vielleicht schon. Ich weiß nicht, ob Familie „ersetzt“ wird, aber ich bin schon davon überzeugt, dass Menschen im Grunde eben doch Herdentiere sind.
Anna Schulte: Wir beobachten ja schon lange, dass die Bindung an einen bestimmten Arbeitgeber, so wie es früher einmal üblich war, nicht mehr so funktioniert. Das klassische Familienunternehmen, mit Herrn Müller an der Spitze, der als eine Art Vaterfigur von oben durchregiert hat – das existiert immer weniger. In einer Zeit, in der gute Mitarbeiter/innen zunehmend schwer zu bekommen sind, suchen Unternehmen aber weiterhin nach einer Form, Menschen in der Organisation zu halten. Das trifft sich mit einem weiteren Trend auf Seite der (jungen) Berufstätigen: Menschen suchen Sinn in ihrer Arbeit. Und den finden sie häufig auch im „miteinander tun“. Bei Neugründungen kann das dann heißen, dass sie „innovative Rechtsformen“ suchen – aber auch bestehende Unternehmen versuchen diese Sinnsuche ihrer Mitarbeitenden und die zunehmende Lust am gemeinschaftlichen Tun abzubilden.
KB: Und über das „miteinander tun“ möchten viele meiner Mandanten eben noch weiter gehen und „miteinander entscheiden“. Sie suchen Gesellschaftsformen, die wiederspiegeln, wie sie arbeiten möchten: auf Augenhöhe.
Da entsteht dann schnell ein Bild von kollektiven Strukturen. Wie ist das denn praktisch abbildbar? Welche Gesellschaftsformen gibt es da?
KB: Möglichkeiten gibt es einige: Die Genossenschaft zum Beispiel eignet sich in vielen Fällen prima. Da zahle ich quasi ein „Eintrittsgeld“ und wenn ich wieder rausgehe bekomme ich das Geld zurück. Da steht der finanzielle Gewinn dann allerdings nicht an erster Stelle, denn an der Wertsteigerung des Unternehmens partizipiere ich nicht. Andere Formen sind GmbHs, die die Rollen von Geschäftsführung und Gesellschaftern nach innen einfach anders füllen als das klassischerweise üblich ist.
Wenn jemand mit der Fragestellung nach der passenden Gestaltung der Rechtsform an mich herantritt ist meine Vorgehensweise sehr klar: Ich schaue mir die Menschen an und die Kultur ihrer Organisation – und erst im zweiten Schritt suche ich die passende juristische Form. Ganz am Schluss steht für mich das beste Steuermodell für die Gesta
ltung. Es gibt sicher viele Juristen, die da anders herangehen – für mich funktioniert es nur so herum.
AS: Da arbeiten wir im Grunde wohl mit ähnlichen Fragestellungen, kommen nur aus fachlich anderen Richtungen damit in Berührung. Während Du als Fachexperte für die rechtlichen Fragen gerufen wirst, stoßen wir mit unseren Kunden genau auch auf diese Fragen, wenn wir dazu arbeiten welche Form der Zusammenarbeit denn die richtige für sie ist, welche Rollen es geben muss usw. Dazu suchen viele dann letztlich auch eine juristische Hülle.
KB: Richtig – und mein Vorgehen ist es eben, nicht die juristisch Hülle zu nehmen und zu versuchen, der Organisation zu erklären wie sie die zu nutzen hat, sondern anders herum. Ich habe neben meinem Jurastudium auch Soziologie studiert und betrachte das Gesellschaftsrecht eher aus der soziologischen Warte. Ich erkenne also, dass bestimmte Funktionen gebraucht werden in Gesellschaften und aus diesem Grund ergeben sich dann die juristischen Anforderungen. Wenn ich also tatsächlich eine Firma darin begleite sich „umzubauen“, also eine neue Gesellschaftsform zu wählen, dann bin ich in meinem Selbstverständnis dazu da, ihnen zu helfen, den gemeinsam beschlossenen Zweck möglichst sinnvoll verfolgen können. Das heißt mit möglichst wenig Reibungen, möglichst wenig Gewalt und möglichst effizient.
Aber entstehen da nicht automatisch Reibungen, wenn „herkömmliche juristische Hüllen“ mit neuen Inhalten und Arbeitsweisen gefüllt werden?
KB: Ja. Es gibt meiner Erfahrung nach immer auch Brüche zwischen Kultur und Recht und die muss man finden und dann stützen. Mit stützen meine ich z.B. folgendes: Wenn ich eine GmbH habe und dennoch alle mitreden, alle auf Augenhöhe arbeiten, was ist dann mit dem Geschäftsführer? Da kann es im schlimmsten Fall passieren, dass Dinge entschieden werden, von denen er gar nichts weiß. Das heißt in solchen Fällen muss ich das „persönliche Verschulden“ des Geschäftsführers umdefinieren in eine Art „Organisationsverschulden“. In der Praxis bedeutet das: Der Geschäftsführer hat eher die Rolle eines Scrum Masters und die geschäftsführerischen Pflichten und Aufgaben sind innerhalb der Organisation verteilt. Im Grunde reduziere ich die Rolle des GFs auf sein Vetorecht und gehe davon aus, dass er es nicht nutzen muss. Das funktioniert aber nur mit super großer Transparenz. Nur wenn alle Beteiligten volle Transparenz haben, komme ich zu diesem Punkt.
Aber juristisch verantwortlich ist ja am Ende eben doch der Geschäftsführer. Wie geht man damit um?
KB: Tja, da wird das Prinzip „der Staat will wissen, wem er auf die Finger hauen kann, wenn etwas schief geht“ zur Gefahr für den gelebten Alltag in der Organisation. Hier spürt man den Bruch zwischen Kultur und Recht sehr deutlich und das meine ich mit stützen. Ich schaffe Augenhöhe innerhalb einer Gesellschaft nur, wenn alle ihr Commitment dem GF geben und sagen: „Du musst dein Vetorecht nicht nutzen“. Alle gehen praktisch in Verantwortung und das Restrisiko muss man dann versichern. Es ist aber im Grunde alles so gebaut, dass die Funktion des Geschäftsführers im klassischen Sinn nicht besetzt ist.
Welche Funktionen braucht Ihrer Meinung nach eine Organisation?
KB: Es gibt einfach bestimmte Funktionen, die eine Organisation braucht, um lebensfähig zu sein. Die müssen alle ausgefüllt werden. In der Kreativwirtschaft spricht man von den 4K: Kreativität, Kapital, Kunden, Kultur. Letztlich ist das ein einfaches Muster, um im Alltagsstress kurz inne zu halten wenn etwas schief läuft und zu schauen: „Wo habe ich gerade ein Problem?“. Viele Unternehmen mit flachen Hierarchien, die ich betreue, hatten zum Beispiel Schwierigkeiten, gut auf die Zahlen zu schauen. Da muss man also klar benennen, dass sich das nicht von alleine und agil regelt – eine/r muss dann eben doch „Finanzen“ auf der Stirn stehen haben. Das heißt in diesen Kontexten dann nicht, dass der- oder diejenige allein entscheidet und die Verantwortung trägt, aber dass diese Person die Finanzen im Blick hat und alle transparent darüber informiert.

Viele meiner Mandanten definieren drei bis fünf Funktionen, die unbedingt ausgefüllt werden müssen. Formell sind die Menschen dann meist auch Geschäftsführer/innen – ganz operativ im Alltag sind die Rollen aber sehr anders ausgefüllt als man das von „klassischen Geschäftsführern“ kennt.
AS: Also geht es primär darum, klar zu benennen, welches Wissen in einer Organisation gebraucht wird, welche Funktionen dafür nötig sind und wie diese ausgefüllt werden. Der Unterschied zwischen hierarchischen Unternehmen und flachen Hierarchien liegt nicht darin, dass andere Funktionen benötigt werden, sondern dass diese anders ausgefüllt werden – von mehr Menschen, mit weniger Machtkonzentration. Kommunikation verläuft ganz anders.
Was ist denn Eure Einschätzung: Sind solche Unternehmen letztendlich wirklich „innovativer“ oder nicht im Grunde unheimlich damit beschäftigt sich selbst zu organisieren?
MQ: Die Frage, wieviel Energie in interne Steuerung fließt, hängt erst einmal nicht von der Rechtsform ab, sondern von der Unternehmensgröße. Ganz unabhängig von der jeweiligen juristischen Form machen wir bei wachsenden Organisationen die Beobachtung, dass sich bei ungefähr fünf bis sieben gemeinsam arbeitenden Menschen etwas ändert. Wenn sich Menschen zusammen tun, funktioniert ein unkompliziertes Miteinander meist bis zu dieser „Schallgrenze“ – danach kommt es zu Problemen und oft auch zu Konflikten. Wir stellen dann die Frage: „Welche Form ist jetzt die richtige für die Funktion, die ihr damit haben wollt?“ In unserer Arbeit ist dabei einer der wichtigsten Leitsätze immer: Form follows function. Hier braucht es interne Steuerung, Rollen … Das kann auch schmerzhaft sein, denn Menschen schätzen es oftmals, ohne definierte Rollen zu arbeiten und merken dann plötzlich, dass das ab einer bestimmen Größe einfach nicht mehr funktioniert. Man kann hier aber trotzdem weiter nach innovativen Formen der Zusammenarbeit suchen – jedoch nicht mit der Illusion, dass sich alles von selbst regelt.
KB: Ja genau, Stichwort Entscheidungsfähigkeit. Da muss ich als Anwalt dann manchmal Großgruppen moderieren, weil sie nicht mehr entscheidungsfähig sind. Wenn GmbHs zum Beispiel plötzlich 10 oder gar 25 Gesellschafter haben, dann droht die Gesellschafterversammlung als höchstes Entscheidungsgremium dysfunktional zu werden. Trotzdem: Ich mache hier die Erfahrung, dass die Umtriebigkeit und das Commitment solcher Gesellschafter das ausgleichen. Die Unternehmen, die ich betreue, schaffen das alle erstaunlich erfolgreich. Es sind manchmal schmerzhafte Prozesse zurück zur Entscheidungsfähigkeit, sie müssen neue Mechanismen finden und gemeinsam beschließen – aber ich bin wirklich begeistert, wie gut die das dann letztendlich doch schaffen. Ich beobachte, dass diese Gesellschaften erstaunlich adaptionsfähig an die Umwelt sind und sehr erfolgreich agieren.
Ganz praktisch schaffen meine Mandanten, dass „Amtsperioden“ geschaffen werden, die Adaption und Beständigkeit gut vereinbaren – also Wissen erhalten und dennoch „frisch bleiben“. Manche meiner Kunden führen da z.B. auch Gremien oder sogenannte Kreise ein.
MQ: Das ist sicherlich ein wichtiger Weg, wobei das Denken in Gremien für uns nicht das Innovative ist. Die „innovative Frage“ für uns lautet dann eher: Inwieweit mache ich die Organisation zum Anliegen jedes einzelnen? Wie muss das System aussehen, damit ich mir den Kopf meiner Organisation mache? Wohlgemerkt: Das meint keine scheinheilige Selbstausbeutungsmentalität.
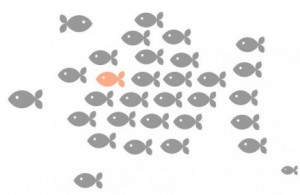
Als Organisationsentwickler malen wir da ungern „Heldengeschichten“. Ziel muss doch eigentlich sein, dass eine Organisation so gestrickt ist, dass die Interessen der Organisation und die der Individuen gekoppelt sind. Ich kann nicht von Organisationsmitgliedern erwarten, dass sie etwas tun, was eigentlich gegen ihr persönliches Interesse ist, weil es der Organisation dient. Sondern das System sollte so sein, dass sich das, was für mich persönlich sinnvoll ist, auch im Sinne der Organisation ist – und umgekehrt.
AS: Hier treffen Organisationen gerade auf neue Wünsche und Anliegen der Mitarbeitenden. Zum Verhältnis der Deutschen zur Arbeit hat die ZEIT jüngst eine spannende Reihe veröffentlicht. Die Fragen nach „innovativen Gesellschaftsformen“ spielt sich aus unserer Sicht auch vor diesem Hintergrund ab.
Wenn Menschen aber Arbeit so viel bedeutet und sie das auch so gern tun, wozu brauchen sieeigentlich die Organisation? Wäre es nicht eigentlich viel attraktiver selbstständig zu arbeiten?
KB: Ich bleibe da beim oben beschriebenen Familienersatz und beim Herdentier. Zudem entlastet es doch auch, gemeinsam Dinge zu tun. Ich muss nicht immer das Rückgrat haben, das ein Selbstständiger und/oder Chef täglich beweisen muss. Ich begegne oftmals Menschen, die mit Mitte 40 völlig ausgebrannt sind und Mitbeteiligung der Mitarbeitenden möchten, auch einfach, weil sie entlastet sein möchten. Irgendwie schwindet, glaube ich, der patriarchale Grundethos.

